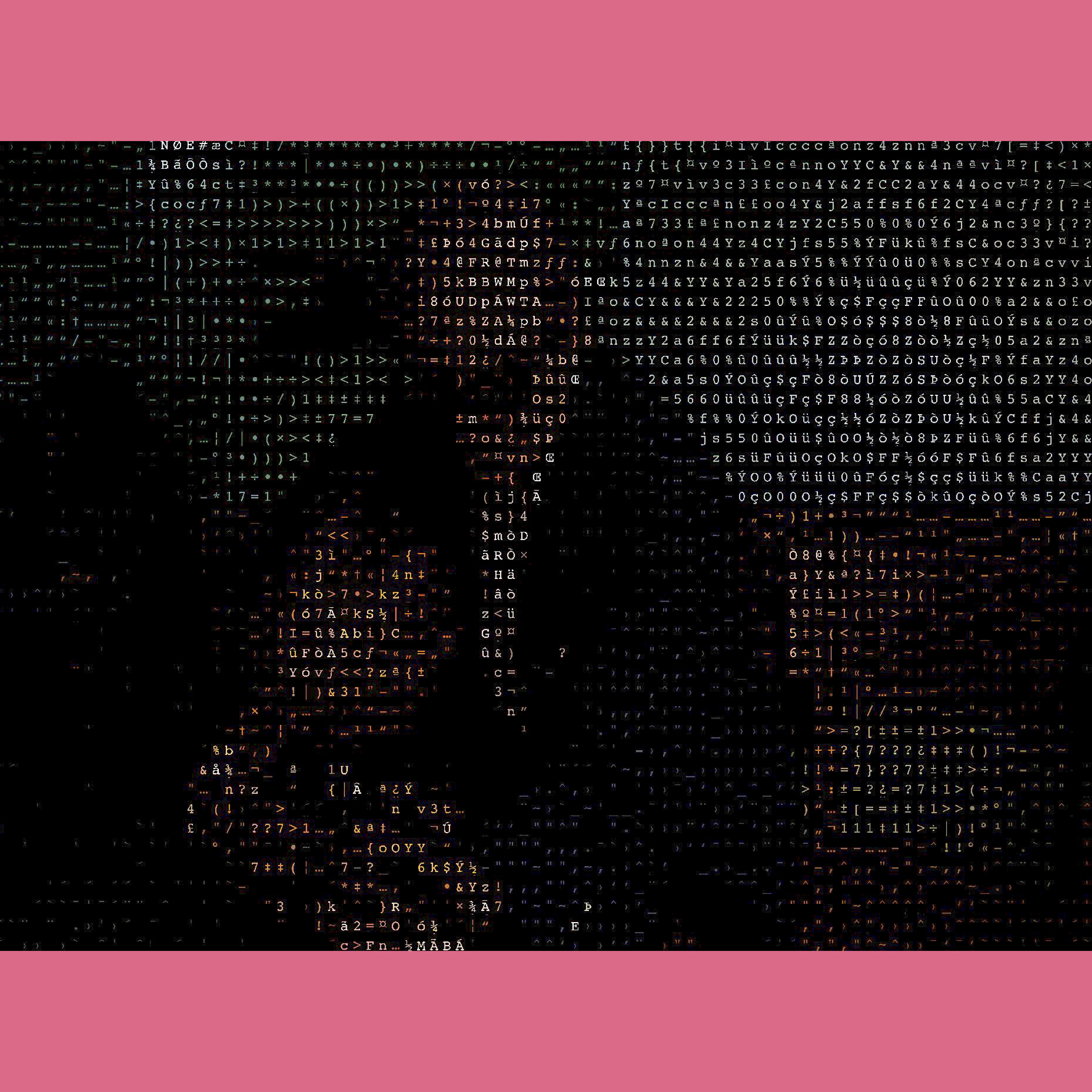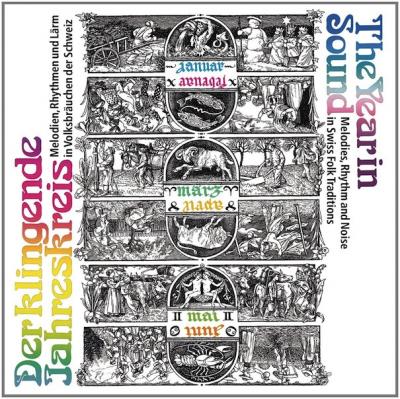50 Jahre getrennt
Im Film El Gusto erzählen muslimische und jüdische Musiker nostalgisch von ihrer Liebe zur algerischen Chaabi-Musik. In den 1950er Jahren haben sie diese Musik gespielt, zunächst in den Cafés, Friseurläden und Bordellen, schliesslich im Opernhaus von Algier. Nach der Unabhängigkeit Algeriens allerdings haben sich die Musiker aus den Augen verloren. Sie sind entweder nach Frankreich migriert, wurden in Algerien ins Gefängnis geworfen oder zwangsumgesiedelt. Ein nostalgischer Film der Filmemacherin Safinez Bousbia über Freundschaft und die grosse Kraft der Musik.
Ich habe meine Gesundheit geopfert für dieses Land, für diese Musik. Und was bekomme ich als Dank? Wenigstens einer könnte sich an mich erinnern und fragen, «was ist mit diesem Sänger passiert, wir sehen ihn nicht mehr?» Wenn ich tot bin, werden sie zusammentreffen und mich würdigen. Ich will aber keine Würdigung. Wenn schon, dann jetzt, wenn ich noch lebe!
Ahmed Bernaoui, Sänger
«Wenn du von Algier redest, redest du automatisch von der Chaabi-Musik» erzählt der Musiker Ahmed Bernaoui im Film El Gusto: «Sie ist meine grosse Leidenschaft. Ich lebe für sie und durch sie.» Viele Hörerinnen und Hörer in Europa teilen seine Leidenschaft – und das nicht bloss seit Rachid Taha das Chaabi-Lied «Ya Rayah» als eingängigen Pop-Ohrwurm vertont hat. Chaabi verarbeitet städtische, ländliche und internationale Stile. Die Lieder beweisen, dass multi-kulturelle Musik viel Kraft und Charme entwickeln können, wenn sie über Jahre an einem Ort von Musikerinnen und Musikern gestaltet, gespielt und gelebt werden, in diesem Fall von jüdischen und muslimischen Musikern in der Kasbah (der Altstadt) von Algier in den 1950er Jahren.
Klavierläufe und Darabuka-Trommeln
Im Zentrum steht einer, der in El Gusto als Avantgardist bezeichnet wird: El Hajj Muhammad El Anka, ein charismatischer Sänger und Musiker. Chaabi galt als Musik der armen Leute und wurde in Cafés, Friseurläden, Hafenkneipen und Bordellen gespielt. El Anka aber sprach am Konservatorium vor und setzte durch, dass Chaabi in den Lehrplan aufgenommen wurde. Im Studium trafen sie sich dann auch alle, die Freunde aus dem Film El Gusto. Ihr Zusammenspiel gewann an Raffinesse. Alles fand mit immer grösserer Leichtigkeit zusammen: Perlende Klavierläufe, virtuose Darabuka- und Riqq-Trommeln, leicht ornamentierende Streicherpassagen, und dazu diese in Nostalgie getunkten Stimmen, in denen heute Alter und Lebensweisheit mitschwingen. Ad hoc gesellten sich auch mal ein Akkordeon hinzu, eine Klarinette, Gitarre, ein Banjo oder ein Cello. Alles schien möglich, in dieser eingängigen und doch so kunstvollen Musik.
Von der Propaganda in die Verbannung
Mit dem Unabhängigkeitskrieg Algeriens von 1954 bis 1962 veränderte sich die Situation drastisch. Anfänglich setzte die Nationale Befreiungsfront (NLF) Musik, darunter auch Chaabi-Musik, als Propaganda-Waffe ein, dann aber forderte der Krieg mit Frankreich seinen Tribut. Chaabi-Musik und ihre Musiker verschwanden aus dem Alltagsbild: Einige der Musiker kämpften im Krieg, migrierten in andere Stadtteile und Dörfer.
Nach der Unabhängigkeit Algeriens 1962 ernannte Präsident Houari Boumedienne die andalusische Kunstmusik zur Nationalmusik. Sie sollte nationale Einheit und Einigkeit betonen und das kulturelle Potenzial des jungen Staates zeigen. Viele Chaabi-Musiker wurden – wie auch die Raï -Sänger in Oran – ins Gefängnis geworfen, gefoltert und geschlagen. Bars wurden geschlossen, Alkohol und Prostitution waren jetzt verboten.
El Gusto – der Trailer
Jüdischen Sängern legte man Nahe, besser mit dem Singen aufzuhören. Sie seien keine Araber, hiess es jetzt – obwohl sie dieselbe Sprache sprachen wie ihre muslimischen Freunde und dieselbe Alltagskultur lebten. Viele verliessen das Land: «Sie stellten uns vor die Entscheidung: entweder Koffer oder Sarg», erzählt ein Musiker.
Die Musik verstummt – nicht für immer
In Frankreich war es nicht einfacher. Hier wurden die Neuankömmlinge abschätzig als «Pieds Noirs» – als Schwarzfüssler – beschimpft. Selbst im mondänen Olympia Konzertsaal in Paris hörten die Diskriminierungen nicht auf: «Du dreckiger Pied Noir riefen sie mir zu», erinnert sich ein Musiker. Bald spielten die jüdischen Musiker keine Lieder aus ihrer Heimat mehr. Vergessen haben sie sie aber nicht.

Diese Geschichte wurde der in Algerien geborenen Filmemacherin Safinez Bousbia zugetragen, von einem der Musikerfreunde. Sie kontaktierte seine alten Weggefährten in Frankreich und Algerien und lässt sie in El Gusto jetzt ihre Lebensgeschichten erzählen. Ihr Ziel: sie sollen sich nach fünfzig Jahren wieder treffen und gemeinsam musizieren – die Juden in Frankreich und die Muslime aus Algier. Denn, das wird im Film schnell klar: Sie alle schwelgen in Erinnerungen an die 1950er Jahre. Sie schwärmen von der Kasbah, der Altstadt von Algier, als kultureller und multi-religiöser Ort, in dem vor allem eine Musik spielte: Der Chaabi.
Algier, meine Liebe
Stadt meiner Familie und Freunde
Ich werde immer an deiner Seite leben
Ich werde dich nie verlassen.
Das Licht wird wieder aufsteigen
Und wir werden glücklich und zufrieden leben, meine Liebe.
Du schönste Stadt.

Biography
Published on January 10, 2014
Last updated on April 30, 2024
Topics
Can a small chinese radio show about Uyghur music stand against the censorshop of the Communist Party of China? Are art residencies useful?
From priests claiming to be able to shapeshift into an animal to Irish folk musicians attempting to unify Protestants and Catholics.
Snap