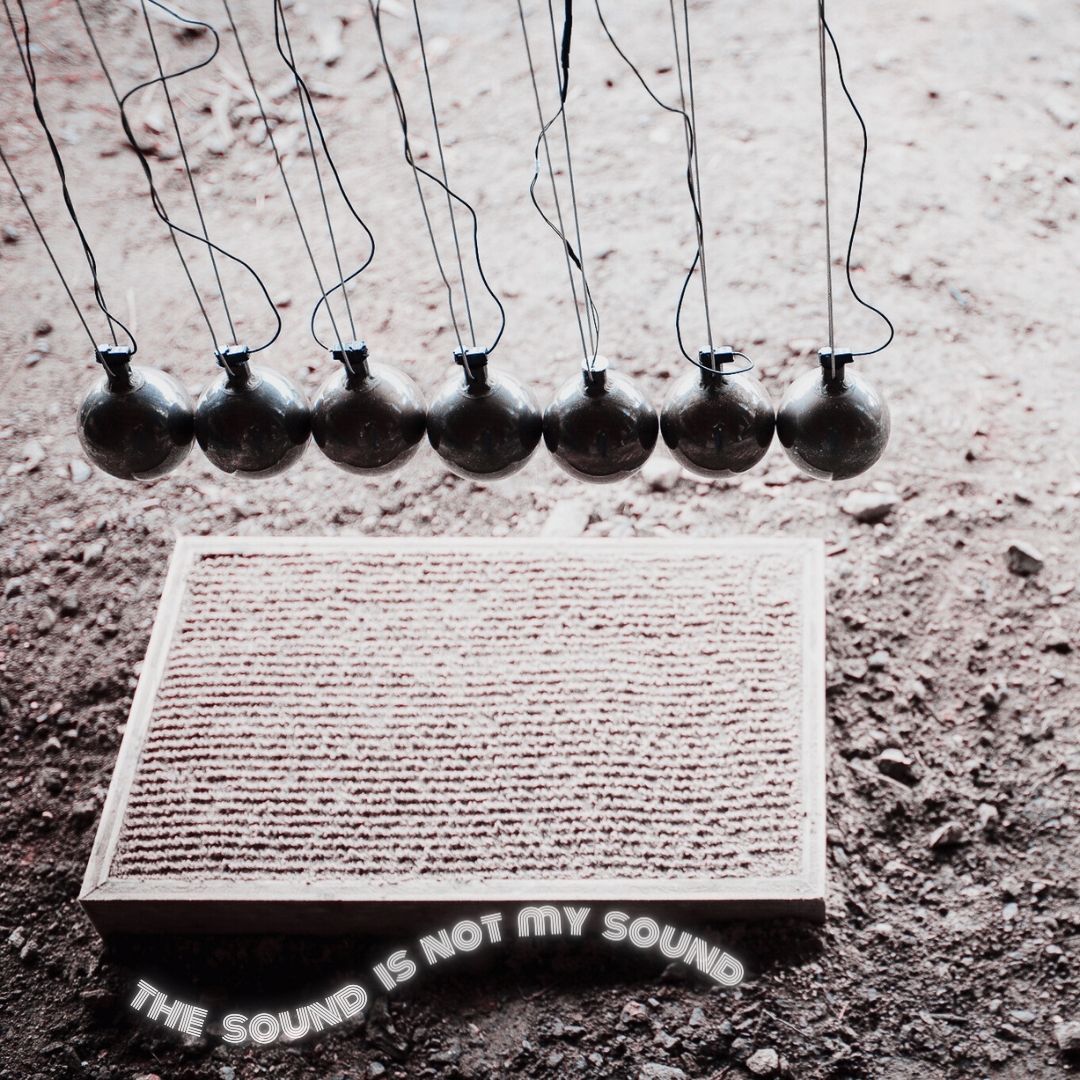Woher kommt die Motivation, ein Festival für Musik aus Iran und der iranischen Diaspora zu organisieren? In diesem Text erinnert sich Klangteppich-Festivalmacherin Franziska Buhre an eine Reise nach New Orleans im Jahre 2016. Ein Erlebnis, das ihre Sicht auf die Geschichte der Musik und die Gemeinschaften, die sie verkörpern, nachhaltig verändern sollte.
Ein scharfer «Klick», ich zucke zusammen. Wir sind soeben ins Taxi eingestiegen und der Fahrer hat sofort die Türen verriegelt – zu unserer Sicherheit. So etwas bin ich nicht gewohnt. Wir kamen doch erst gerade aus einem überwältigenden Konzert in der Candlelight Lounge in Tremé. Eine Freundin hat mich 2016 eingeladen, mit ihr New Orleans zu besuchen, in den Wochen rund um das New Orleans Jazz & Heritage Festival Ende April. Ich bin so oft überfordert, wie in diesem Moment. Ein anderes Mal rät mir eine Gesprächspartnerin im Stadtteil Ninth Ward, zum nächsten Termin lieber ein Taxi zu nehmen, dabei ist die Strecke vielleicht zehn Minuten Fussweg – zu gefährlich für eine Besucherin wie mich – am helllichten Tag. Polizei- und Waffengewalt sind in New Orleans allgegenwärtig, auch wenn sie für eine privilegierte weisse Person wie mich nicht sichtbar werden. 2022 wurden 280 Menschen in New Orleans ermordet, eine der höchsten Mordraten in einer US-amerikanischen Stadt (Colton und Baehr 2023).
Von Bethany Ewald Bultman, der Gründerin der New Orleans Musicians’ Clinic, höre ich 2016 zum ersten Mal den Ausdruck «Food Deserts»: weite Gebiete in Nachbarschaften, in denen es keine frischen Lebensmittel zu kaufen gibt. Bis in die 1960er Jahre konnten fahrende Händler*innen mit «truck farms» in Stadtteilen mit mehrheitlich afroamerikanischer Bevölkerung frisches Gemüse und Obst verkaufen, ältere Bewohner*innen erinnern sich noch an diese Wagen. Für deren Niedergang sorgten auch politische Entscheidungen zugunsten der Lebensmittelindustrie, die ihre zucker- und fetthaltigen Produkte mit Gewinn in Supermärkten absetzen will. Schon vor der Corona-Pandemie war die Lebenserwartung afroamerikanischer Männer in Louisiana mit 71 Jahren vier Jahre niedriger als jene weisser US-Amerikaner. An COVID-19 starben signifikant mehr Afroamerikaner*innen und seither fiel die Lebenserwartung afroamerikanischer Männer in Louisiana auf unter 70 Jahre (Habans et al. 2020). Sehr viele leiden an Mangelernährung und Diabetes.
Der Musikvermittler
Bruce Sunpie Barnes ist Musiker, Sänger, Park Ranger und Big Chief der North Side Skull and Bone Gang, einer Gruppe von Black Masking Skeletons, die seit zwei Jahrhunderten die Menschen am Morgen des Mardi Gras aufwecken und sie an die Kostbarkeit des Lebens erinnern. Barnes hat trotz des Trubels rund ums Jazzfest Zeit gefunden, mit mir zu sprechen. Wenn ich mir das Gespräch heute anhöre, kommen mir meine Fragen alle falsch vor. Er spricht über Musik, seine Gang, den Wirbelsturm Katrina und über den Rassismus, den er täglich erlebt:
«It’s what you’re being subjected to. Like me walking up and down the street I know damn well how people gonna handle me, consciously and unconsciously. I’m a large Black male, they have all kinds of reactions, I’ve seen it every day of my life. I’m not suspicious, I know how I get handled. Even if they think about it they don’t feel it because they’ve never had guns stuck to their head by the police repeatedly just for being Black. Arrested, taken to jail, for being Black, in the city that’s majority Black population.»
Barnes spielt Akkordeon, Mundharmonika und singt Zydeco, den er als «Black Creole Music» beschreibt. Schon sein Grossvater, geboren 1844, hatte Akkordeon gespielt. Barnes ist ein unverzichtbarer Vermittler der Musikgeschichte von New Orleans, die er auch in intergenerationellen Projekten mit Kindern und älteren Musikern wachhält. Bis heute ist er der beeindruckendste Mensch, dem ich je begegnet bin.
Der Kämpfer
Charles Taylor ist Big Chief der White Cloud Hunters Mardi Gras Indians und heute Ende Sechzig (Viddal 2023). Seine Grossmutter war Cherokee, er begann mit dem «Black Masking» 1956. Während Hurricane Katrina im August 2005 war er in New Orleans, wurde nach drei Tagen aber zwangsevakuiert. Da waren schon über achtzig Prozent der Stadt überschwemmt. Nach Aufenthalten in Texas und Kalifornien kehrte er nach New Orleans zurück. Doch infolge eines gewaltsamen Angriffs erlitt er erst einen Schlaganfall, dann einen Herzinfarkt. Seine Frau und er mussten oft umziehen, ihre Ehe ging in die Brüche. Taylor erkrankte schwer, er erhielt eine Lebertransplantation und seine Beine mussten operiert werden. «So I tell everybody I been through hell and back but I’m making it you know», erzählte er mir 2016 in einem so starken Akzent, dass ich nach meiner Rückkehr einen Freund aus Georgia bitten musste, mir bei der Transkription des Gesprächs zu helfen. Währenddessen hatte ich sehr wenig verstanden und nur gewusst, dass ich seine Geschichte hören wollte. Ich fragte ihn nach der Praxis seiner White Cloud Hunters:
«It’s a lot of excitement and it’s fun. You have people playin’ bass drums, you have ‘em playin’ cowbells, they playin’ tambourines and everybody backgrounding the singer. If you singin’ ‹Shallow Water›, when you make that version line the background, the people will say ‹Shallow Water Oh Mama, Yeah›. And every song have a meaning to it, like I see a lot of Indians maskin’ today and I ask ‘em what is shallow water? What it mean? And they probably tell you their little version of it. They wouldn’t be able to tell the exact meaning of it. It means wishes. On the real point, it‘s wishes.»
In Erinnerung an diese beiden Begegnungen, an die Gespräche mit einigen weiteren Musiker*innen, an die Konzerte mit Ragtime, Brass Bands, Funk, freier Improvisation, Folk, mit New Orleans Jazz frage ich mich nach wie vor: wie können Menschen unter diesen widrigen Bedingungen, dem Rassismus, der Waffengewalt, der katastrophalen medizinischen Unterversorgung, der Bedrohung durch Naturkatastrophen, der Welt nur so wunderbare Musik schenken?
Die Wirklichkeit ist komplex
Mit den Erzählungen vom «Ursprung des Jazz» in New Orleans, wie sie insbesondere in deutschsprachiger Jazzpublizistik seit den 1950er Jahren reproduziert werden, habe ich nie etwas anfangen können. Sie waren schon immer eindimensional und essentialisierend: als wäre Jazz aus der Begegnung von «Schwarz» und «Weiss», von Afroamerikaner*innen mit europäischer Musik und Instrumenten entstanden. Eine grössere Vielfalt an Einflüssen, an komplexen Traditionen und Geschichten habe ich bis dato nirgendwo erlebt. Das war die Überforderung, mit der ich in New Orleans in jedem Moment gerungen habe. Wenigstens schaffte ich es noch, die Sammlung an Filmen von Jules Cahn im Museum und Forschungszentrum The Historic New Orleans Collection zu entdecken und zu bereuen, dass ich davon nur einen Bruchteil ansehen konnte. Cahn hatte ab den späten 1950er bis in die 1970er Jahre das Musikleben auf den Strassen von New Orleans dokumentiert, seine Aufnahmen sind in Bruchstücken in der Serie Treme von 2010–12 zu sehen.
Wie ich über Musik denke und sie höre, hat dieser Besuch von Grund auf verändert. Ich erkenne Komplexität an, die ich unmittelbar nicht zu begreifen vermag und zu deren verschiedenen Ebenen ich erst durch zuhören, erleben und die Aneignung von Wissen ein wenig vordringe. Menschen mit Offenheit zu begegnen, deren jahrhundertelange Entrechtung und gegenwärtige Ausgrenzung ich nicht aus eigener Anschauung kenne und nach Wegen zu suchen, wie ihre Stimmen hörbar, ihre Präsenzen sichtbar werden können. Nach innen zu schauen, welche Spuren von Flucht, Hunger, Ausbeutung, Vielsprachigkeit, Zerrissenheit und Bindung an Orte es in meiner Familiengeschichte gibt.
Nach dem Besuch in New Orleans habe ich angefangen, Konzerte zu organisieren. Mich seit 2017 mit Iran und der iranischen Diaspora auseinanderzusetzen, kann ich dank dieser Erfahrung.