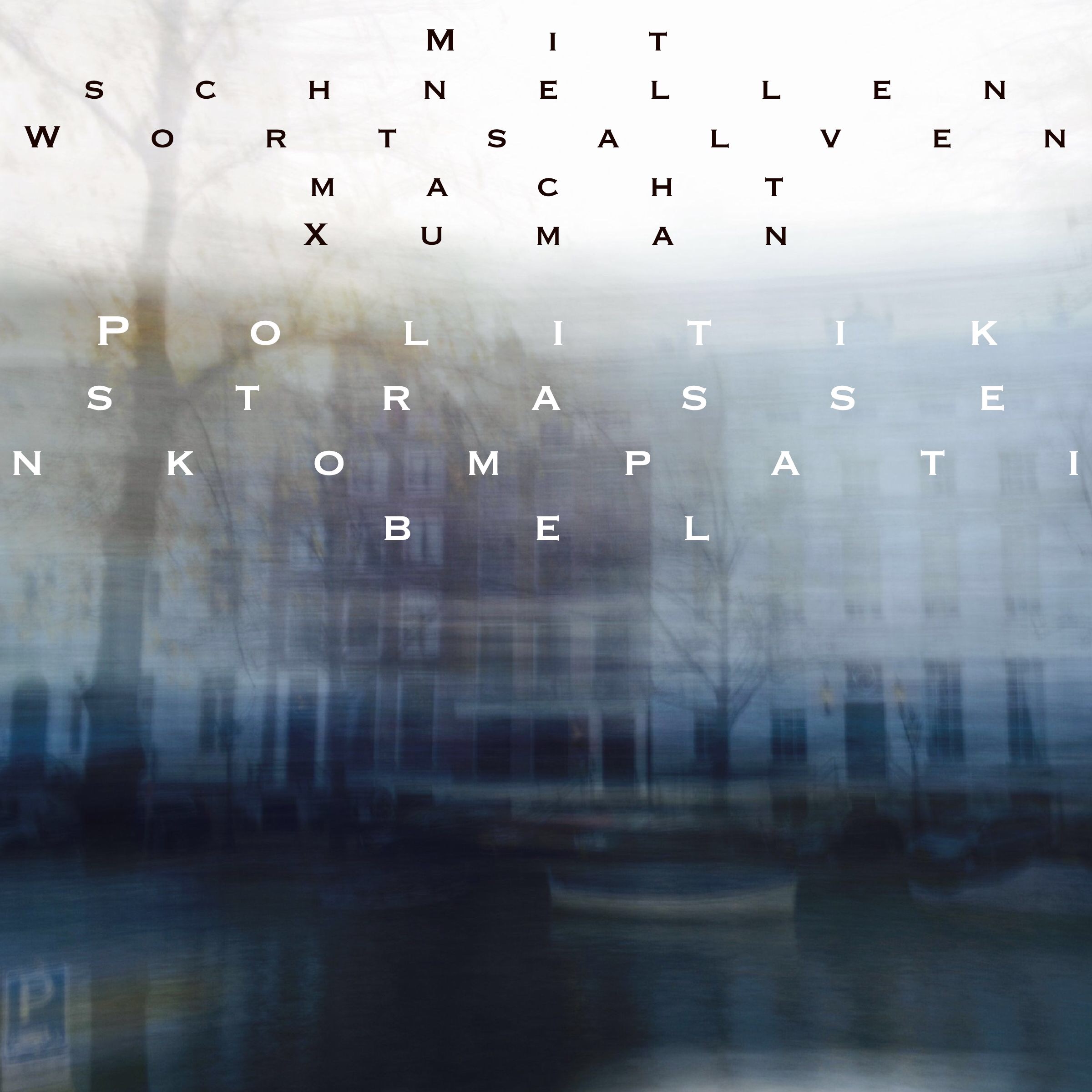Solange Pop seine eigenen Spielregeln thematisiert, wird schon etwas Gutes herauskommen – längst gilt diese Formel nicht mehr, wie sich auch an der Selbstinszenierung Ariel Pinks zeigt. Das britische Künstlerkollektiv PC Music überwindet dagegen die bekannten Strategien des Meta-Pop und weist einen Weg aus der Hölle des Bescheidwissens. Hinterfragt Pop sich selbst oder spielt er nur mit den eigenen Versatzstücken?
Eigentlich funktioniert Geschmacksbildung unter Popkritikern ganz einfach: Als hohe Schule gilt, wenn der vermeintliche Massenbetrug Popmusik genau über seine Spielregeln Bescheid weiss und diese immer wieder offenlegt. Jedes Jahrzehnt hatte seine Posterboys dieser auch als Meta-Pop bezeichneten Musik: Scritti Politti in den Achtzigern, Jim O’Rourke in den Neunzigern und Ariel Pink in den Nullerjahren. Ariel Rosenzweig, wie der besagte Posterboy des postmodernen Lo-Fi-Pop mit bürgerlichem Namen heißt, rückte die Zitathaftigkeit seiner Musik in den Vordergrund, indem er ihre Stilelemente – Sixties-Pop-Gitarren und Synth-Pop-Sequenzen – unter einer dicken Schicht Kassettenrauschen begrub. Und er verursachte kürzlich eine Krise des Selbstverständnisses, die in den Medien distinguierter Pop-Fans öffentlich verhandelt wurde.
Ariel Pink machte in den vergangenen Monaten durch eine Reihe von Interviews von sich reden, in denen er sich mit sexistischen Aussagen profilierte: Madonna sollte wegen ihres Alters lieber mit der Musik aufhören – oder eben einen jungen Producer wie Ariel Pink an die Regler lassen. Die kanadische Indie-Musikerin Grimes nannt er «dumm und zurückgeblieben», ausserdem sei sie nur neidisch auf ihn, weil er die gleiche Musik schon früher gemacht habe. Und die Frau, die ihm nach einem misslungenen Date Pfefferspray ins Gesicht sprühte, muss selbstverständlich eine «Feministin» gewesen sein. «Jeder ist ein Opfer. Ausser kleinen weissen Männern, die lediglich ihre Mutter stolz machen und nebenbei ein paar Brüste anpacken wollen», erklärte er später.
Ein Nerd unter seinesgleichen
Damit waren die Leser der Independent-Medien mittendrin im Dilemma. Denn eigentlich macht Ariel Pink dem kleinen Einmaleins des aufgeklärten Popfans zufolge alles richtig. Seine Musik lässt jeglichen Authentizismus vermissen, Pink beschreibt sich selbst als «Betamännchen», als Nerd unter seinesgleichen und überhaupt sagen Menschen, die ihn persönlich kennen, eher nette Dinge über ihn. Aber offensichtlicher Sexismus wird selbst in der Jungsdomäne Indierock nicht goutiert – zumindest wenn er nicht als Fotostrecke in der Vice daherkommt. Am Ende der zumeist recht ausführlichen Reflexionen auf Websites, in Magazinen und Blogeinträgen über die Person die Persona Ariel Pink stand deshalb in der Regel ein Kompromiss: Man muss den Autor von seinem Werk trennen. Privat mag Ariel Pink ein Martenstein mit Kurt-Cobain-Frisur sein, in seiner Musik bleibt er ein intertextuelles Fabelwesen.
Gleichwohl zeigt sich in der Selbstinszenierung der Person Ariel Pink eben die Zitathaftigkeit, die ansonsten nur seiner Musik zugeschrieben wird. Sein Vorbild dabei ist Sleaze-Rocker Kim Fowley, der auf »Pom Pom«, dem jüngsten Album Ariel Pinks, als Produzent mitwirkt. Fowleys Ruf als Frauenhasser beruht auf seiner Karriere als Produzent von The Runaways in den späten Siebzigern. Cherie Currie, die ehemalige Sängerin der Band, erzählte nach ihrem Ausstieg, wie Fowley vor den Augen der Band Sex hatte und das als »Sexualkundeklasse« bezeichnete. Schon damals kultivierte Fowley das Image des alternden Lüstlings und selbst eine schwere Krebserkrankung konnte daran nichts ändern. Es ist genau die gleiche Ambivalenz, in der sich Ariel Pink bewegt. Einerseits soll sein Sexismus vermutlich als Zitat und spielerische Inszenierung begriffen werden. Ebenso deutlich wird aber, dass Pink sein Verhalten nicht hinterfragt. Er spricht im Jargon der Uneigentlichkeit, aber eigentlich ist er mit den Geschlechterrollen ganz zufrieden.
Das zeigt sich auch auf «Pom Pom». Auf siebzehn Tracks hechelt sich Pink wieder einmal durch die Geschichte von Lo-Fi und Garage Pop und biegt dabei ein paar Mal in Richtung New Wave ab. In «Black Ballerina» programmiert er einen leicht hakelig klingenden Rhythmuscomputer-Beat mit ein paar billig klingenden Synthesizern. Vor diesem Hintergrund stellt sich Pinks Erzähler vor, wie Condoleezza Rice in einem Strip-Club in Los Angeles tanzt, inden ein Großvater seinen Enkel eingeladen hat – um aus ihm einen ganzen Mann zu machen, versteht sich. «Nude Beach a Go Go» ist die schmierige Variante eines Beach-Boys-Songs, in dem er die Ramdösigkeit einer typischen Doo-Wop-Textzeile mit Chorgesang und den leicht spießigen Phantasien von einer Orgie am FKK-Strand mischt. Dabei hat Ariel Pink die Lo-Fi-Ausbrüche seines Frühwerks gegen einen Pastiche von Stilen eingetauscht, bei dem nur noch das Dauerrauschen daran erinnert, dass man es nicht mit einer Platte aus den sechziger Jahren zu tun hat.
Meta-Pop und Referenzsysteme
Die Diskussion um Ariel Pink weist auf eine Lücke in der Auseinandersetzung mit Meta-Pop hin. Abgenickt wird die Referenz an sich, das Spielen mit Popgeschichte – weshalb und zu welchem Ende man Popgeschichte metaisiert, bleibt hingegen weitgehend offen. Das Mittel wird dabei zum Zweck, die Verfremdung zum Ausweis des Bescheidwissens. Es ist das Gegenteil dessen, wofür der russische Schriftsteller und Literaturtheoretiker Viktor Schklowsky einst den Begriff der Ostranenie prägte: Die künstlerische Verfremdung wird zur Transzendenz der Realität, weil sie das automatisierte Sprechen und Wahrnehmen des Alltags aufbricht. In der Diskussion um Meta-Pop werden die Automatismen jedoch häufig nur verfeinert: Die Zeichensysteme bleiben bekannt, nur der Kreis der informierten Leserschaft wird kleiner. Abnicken halt. Dabei könnte das doch auch anders gehen: Nämlich wenn sich die Meta-Pop-Musiker und ihre Fans nicht mehr als Posterboys (ja, männlich!) mit entsprechend großer Musiksammlung präsentierten, sondern bewusst dorthin gingen, wo die Wiederholung eine Form der Verfremdung ist.
Seit gut anderthalb Jahren veröffentlicht das britische Kollektiv PC Music Tracks auf seiner Soundcloud-Seite. Seine Mitglieder verbergen sich hinter Pseudonymen und Avataren, die wie Stockphotos aus einer nahen Zukunft gestaltet sind, Animefiguren im britischen Working-Class-Look. Ihre Musik ist ein Amalgam aus den verschiedenen Dance-Stilen: die grellen Videospielsynthesizer von Grime treffen auf hochgepitchte, programmierte Vocals von Eurodance-Tracks der Jahrtausendwende. Das klingt generisch und soll es auch. Die Avatare von PC Music sind in einem Maße austauschbar, dass SWsie jedes Auskennertum unmöglich machen.
Parodie und Kawaii
PC Music sind die Vervollkommnung der Branding-Strategien, die Nachwuchsmusikern heute auf Branchentreffen als Konzept zum Überleben in der Musikindustrie empfohlen werden. QT, das gemeinsame Projekt von PC-Music-Labelchef A.G. Cook und Sophie, tritt nicht als DJ- und Produzententeam auf, sondern als Marketingveranstaltung für einen Energydrink. Es ist eine Parodie auf die Allgegenwart des Sponsorings durch den Getränkehersteller Red Bull, ohne das kaum eine mittelgroße Danceparty heute noch auskommt. «Ich habe den Drink eigentlich hergestellt, um eine Art persönliche Assistenz zur energetischen und psychischen Interaktion zu produzieren und auf diesem Gebiet die Konnektivität zu verbessern», hat der QT-Avatar in einem Interview mal erklärt. Das erinnert an die Sprache von Barcamps und die Selbstoptimierungslyrik der Einspieler von Casting-Shows zugleich und ist typisch für den Populismus, der dem Projekt zugrunde liegt.
Was nicht bedeutet, dass die Parodie nicht ernst wäre, auch wenn dies wegen der offensichtlich niedlichen Kawaii-Ästhetik nicht sofort vermittelbar ist. Die Kritik verbirgt sich bei PC Music trotz der knallbunten Oberfläche in den kaum verständlichen Stimmsequenzen. GFOTY (Girlfriend of the Year) zählt auf «Friday Night» die gesamte Tristesse des Ausgehens am Beginn des Wochenendes zwischen Cocktails und Sex auf der Toilette auf. In Hannah Diamonds Track «Pink and Blue» wird die dumpfeste Form der Heteronormativität durch das Aufreihen von Phrasen in ihrer ganzen Absurdität vorgeführt – die übermässig euphorisierten Stimmen dazu werden im Computer generiert. PC Music ergänzen den schlecht gelaunten Sozialrealismus der Sleaford Mods um einen Realismus, der die künstliche Euphorie als Bedürfnis ernstnimmt und als Geschäftsmodell durchschaut.
Und sicher wird es wieder nur eine kurze Zeit dauern, bis auch die Kawaii-Welt von PC Music ihren Weg in die abnickende Kuratorenkennerschaft findet. Die mit dem Label befreundeten Macher des DIS Magazine sind zumindest 2016 für das Programm der Berlin Biennale verantwortlich.