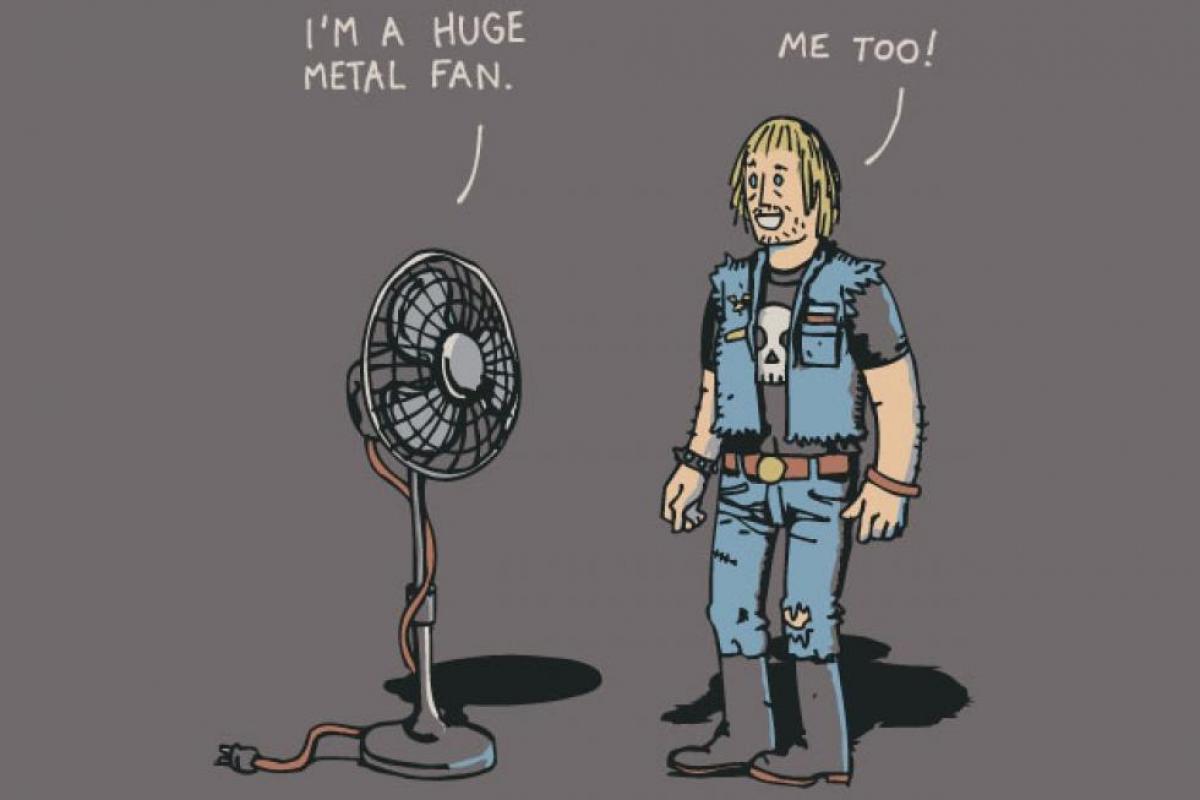Sieben Jahre nachdem Hurrikan Katrina New Orleans verwüstet hat, sind fiebrige Brassbands und tanzende Mardi Gras Indians populärer als je zuvor – und das weit über Louisiana hinaus.
Es ist Sonntag in New Orleans: Das kann man im Treme-Viertel weder überhören noch übersehen. Schwarze Männer in Anzügen und Melonen, Mitglieder eines örtlichen Social Aid and Pleasure Clubs, schwenken Girlanden, tanzen durch die von Schlaglöchern übersäten Strassen. Hinter ihnen das gewaltige Gebläse der Rebirth Brass Band. Tubaspieler Phil Frazier sieht man die Anstrengung an – er ist mit seiner Combo bereits mehrere Stunden über den brennenden Asphalt marschiert, die schwüle Luft droht ihm den Atem zu nehmen.
Und doch drückt er einen gewaltigen Basslauf nach dem anderen aus seinem Rohr: Adaptierte Dancefloor- und Jazz-Standards, zu dem das vielhundertköpfige und zunehmend betrunkene Gefolge – die Second Line – ausgelassen springt, vorwärtsschiebt, auf Autodächern trommelt oder einen dieser eindeutig zweideutigen Tänze inszeniert, bei der die einen auf allen Vieren kriechen, während die anderen breitbeinig und mit schwingenden Beckenbewegungen über sie hinwegsteigen. Angesichts eines solchen Umzugs stillzustehen heisst, sich gegen den Feiergeist zu stellen – in New Orleans ein kapitales Verbrechen, wie jeder Einheimische bestätigt. «Man kann Häuser und Wohnblocks zerstören», sagt Phil Frazier. «Aber man kann die Musik in uns nicht auslöschen.»
Trompete spielen statt rappen
Sieben Jahre nach Hurrikan Katrina feiert New Orleans eine musikalische Wiedergeburt. Nicht nur, dass die Rebirth Brass Band endlich mit einem Grammy die überfällige Anerkennung der Musikindustrie bekommt, dass mit Trombone Shorty ein Nachwuchsmusiker der örtlichen Bläserszene zum internationalen Star aufläuft, dass David Simon, der gefeierte Autor und Fernsehproduzent von «The Wire», mit der HBO-Serie «Treme» auch Rest-Amerika am Enthusiasmus und Improvisationsgeist der örtlichen Clubs und Strassenparaden teilhaben lässt. Nein, die eigentliche Sensation findet täglich auf den Strassen des Mississippi-Hafens statt: Es ist die stolze Inszenierung der eigenen Folk-Kultur.
Selbst fast schon begrabene Traditionen feiern eine Renaissance: Da gründen sich neue Stämme der Mardi Gras Indians, erhalten die Voodoo-Tempel Zulauf aus allen Bevölkerungsschichten, machen sich Dutzende von jungen Brassbands die Strassen streitig. Sieben Jahre nach dem verheerenden Wirbelsturm gibt es in der Stadt mehr Livebühnen und Clubs als je zuvor. Und obwohl im French Quarter die Strassenmusik offiziell verboten ist, hört man ständig von irgendwoher eine Brassband schmettern. No-Names meist, die ihren Vorbildern von der Rebirth, den Soul Rebels, der Hot 8 oder Stooges Brassband nacheifern.
Jugendliche aus den Projects, für die der Bläserjob oft die einzige Alternative zu einer Karriere im Drogenhandel ist. «Überall in Amerika», hat Frazier erzählt, «wollen die Kids Rapper werden. In New Orleans träumen sie von einer eigenen Trompete.» Der Improvisations-geist des Jazz lebt: Neue Alben von Trombone Shorty oder Dr. John geben einen Eindruck, wie vital der New-Orleans-Groove immer noch ist, wie selbstverständlich er alle Einflüsse von afrikanischem Highlife bis Hip-Hop-Beats, von Funk-Bässen bis Free Jazz absorbieren kann.
Lange bevor Hip-Hop kam
Der drohenden Gentrifizierung von Traditionsvierteln wie Treme, dem Abgrund an Armut und Kriminalität, der sich in Mid City immer noch auftut, steht ein wachsendes Bewusstsein für den eigenen kulturellen Reichtum entgegen. So mischen sich vermehrt politische Stimmen in den musikalischen Gumbo: «New Orleans hat immer anders getickt als Rest-Amerika», sagt der afroamerikanische Beat-Poet Chuck Perkins. «Unser Lebensstil feiert den sinnlichen Genuss, die kulturelle Vielfalt. Deshalb verhielten sich Teile Amerikas sehr zwiespältig, was den Wiederaufbau nach Katrina betrifft.»
Perkins hat mit seiner bunt gemischten Truppe Voices of New Orleans gerade das Album «Love Song for Nola» eingespielt, eine Mischung aus Gesellschaftskritik und Liebeserklärung an seine Heimatstadt: «Der Mythos vom Melting Pot, das ist hier tägliche Realität. In welcher anderen Stadt findest du schon Rapper mit goldverblendeten Zähnen, die jede Zeile von Louis Armstrong zitieren können?» Auf der Bühne des Clubs Istanbul lässt Perkins mit seiner Band die verschiedensten lokalen Stile aufeinandertreffen: Jason Marsalis, der jüngste Bruder von Wynton Marsalis, spielt da Schlagzeug. Uganda Roberts schlägt die Congas. Der Brassband-Veteran Corey Henry steuert die Posaune bei, und neben einem Bounce Rapper chantet mit Irving «Spyboy Honey» Banister ein waschechter Mardi Gras Indian kreolische Mantras: «Handa wanda oh mama.»
Darüber rappt Chuck Perkins seine mal zärtlichen, mal wütenden Zeilen. Erzählt von einer irrwitzigen Stadt, die gleichzeitig die höchste Mordrate und die höchste Musikerdichte Amerikas hervorbringt.
Nach Katrina umarmten die New Orleaner trotzig, was sie vorher als Selbstverständlichkeit gesehen hatten: Die Second Lines, die Brassbands, die Mardi Gras Indians. An jedem anderen Ort der Welt würde Irving «Spyboy Honey» Banister in dem perlenbestickten, neonrosa Federkostüm wie eine Jahrmarktfigur wirken. In New Orleans ist er ein Held der Strasse. Seine Auftritte mit Chuck Perkins stellen schon den kommerziellsten Aspekt seiner Musik dar.
Sonntägliche Proben und Strassenparaden
Ansonsten spielen sich die sonntäglichen Proben und Strassenparaden miteinander rivalisierender Mardi-Gras-Indian-Stämme in armen schwarzen Nachbarschaften ab, in die sich nur selten Touristen verirren: «Wir heissen Mardi Gras Indians», erklärt Irving Banister, Vize-Häuptling des Stammes Creole Wild West, «weil man uns früher nur während Mardi Gras zu Gesicht bekam. Damals war es Schwarzen nicht erlaubt, am Mardi Gras teilzunehmen. Also ernannten sich schwarze Männer selbst zu Indianern, auf diese Weise zollten sie den eingeborenen Amerikanern Tribut. Die Indianer hatten einst entlaufene Sklaven bei sich aufgenommen und ihnen die Kunst des Perlenstickens beigebracht.»
Die Mardi Gras Indians sind heute populärer als je zuvor. Die Americana-Chanteuse Emmylou Harris oder der Jazzer Donald Harrison bringen sie auf die Bühne. Und der Bürgermeister Mitch Landrieu dankte ihnen im Namen des offiziellen New Orleans: Ohne ihre Rückkehr wäre New Orleans ärmer, sagte er. Zwar nahmen bereits Dr. John, die Meters und die Neville Brothers in der Vergangenheit die Chants der Indians auf. Aber erst jetzt interessiert sich eine breite Öffentlichkeit für die dahinterstehenden Traditionen.
Zwischen Geist und Geld
Ihrem Wesen nach sind die Mardi Gras Indians Zusammenschlüsse schwarzer Arbeiter. Teils dienen sie als spirituelle Geheimgesellschaft, teils erfüllen sie soziale Aufgaben in ihrer Nachbarschaft. In New Orleans gibt es rund 15 Stämme, und in letzter Zeit wurden sogar neue gegründet. Und das trotz des enormen Zeit- und Geldaufwandes: Jeder Mardi Gras Indian muss nicht nur lernen, die alten Voodoo-Chants zu trommeln und zu tanzen. Er muss auch Tausende von Dollars und unzählige Stunden für das Nähen seines Federkostüms investieren – und das jedes Jahr aufs Neue.
Die Brassbands und die Mardi Gras Indians waren die erste Strassenmusik – lange bevor Hip-Hop kam. Wenn es bis vor wenigen Jahren noch so aussah, als würden sie lediglich als Folk-Relikte überleben, hat der Melting Pot beide Traditionen wieder nach oben gespült. So befeuert der Mardi-Gras-Indian-Funk zahllose Combos im Mississippi-Hafen, während die Brassbands jenseits der traditionellen Second Lines und Jazz Funerals als unabdingbarer Party-Treibstoff gelten. Egal, ob Geschäftseröffnung oder CD-Release eines Bounce-Rappers: Irgendwo wippt der Riesenschalltrichter einer Tuba durch die Menge. Ihre vibrierenden Funkläufe unterfüttern das riffende Crescendo der Saxofone und Posaunen, befeuern eine plötzlich explodierende Trompete, halten den Rhythmus, wenn alle in einer wilden Schlacht über- und nebeneinander herblasen. Und dann fallen plötzlich alle in denselben Beat.
Wie hatte es Chuck Perkins doch in einem seiner Gedichte formuliert:
We’ll work today
If you play tonight
That makes us alright
The sounds of your horns
Gives us strength to fight.