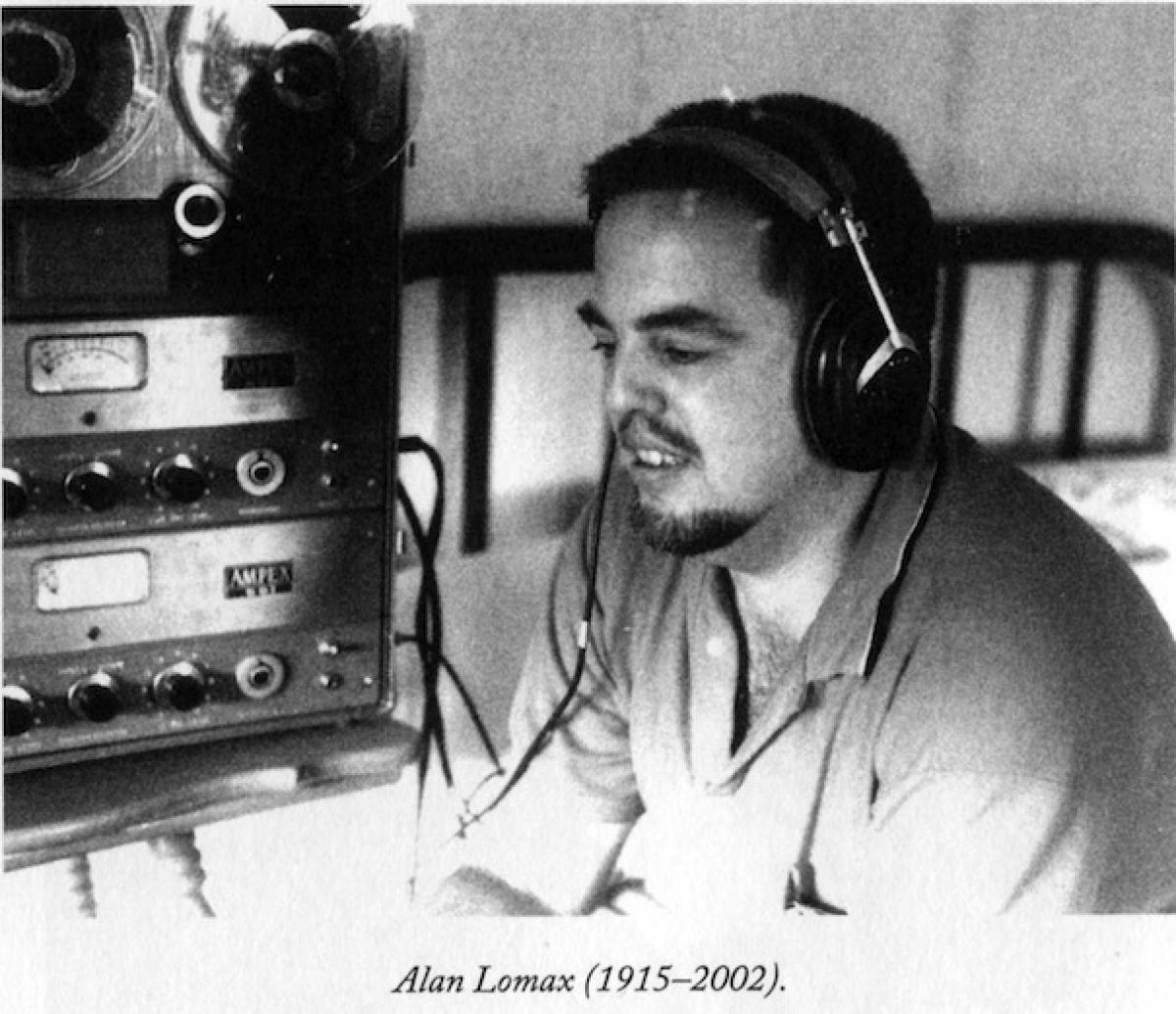«Bund»-Musikjournalist Ane Hebeisen begleitet die Berner Band Faranas auf ihrer Tour durch Burkina Faso. In seinem Blog berichtet er von den Stationen der helvetischen Charme-Offensive, wilden musikalischen Begegnungen bei 40 Grad Hitze und vom Erfolg der Aktion «CH-Afrobeat für Afrika».
Tag 1: Anti-Brumm-Härtetest
Ouagadougou. Temperatur: 40 Grad. Stimmung: zwischen freudiger Erwartung und linder Paranoia.
Sie sind angereist, um Afrika den helvetischen Afrobeat zu unterbreiten und nun sitzen sie im Frühstücksfernsehen der burkinischen TV-Station Canale 3 und sprechen über die Demokratie, die nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der zehnköpfigen Band hochgehalten wird.
Vom Tourplan gestrichen: Mali
Die Berner Gruppe Faranas wurde vom Festival Jazz a Ouaga an den Äquator geladen. Von der Schweiz aus hat man weitere Konzerte organisiert, darunter wäre auch ein Auftritt am Festival Bamako Jazz in Mali gewesen, aber als dort finstere bärtige Herren die Macht ergriffen, denen es gefiel, ihre Pressekonferenzen in Tarnanzug und mit Maschinengewehren zu absolvieren, wurde von berufener Stelle geraten, diese Gegend aus dem Tourplan zu streichen. Und nun ist also Öffentlichkeitsarbeit in der Hauptstadt von Burkina Faso angesagt.
Eigentlich war der Auftritt im Frühstücksfernsehen als Live-Happening geplant, aber weil der Strom in Burkina Faso ein launischer Gespiele ist, musste kurzerhand umdisponiert werden. Das Warten hatte zur Folge, dass nicht nur die Schweizer Faranas-Abgesandten unschön in Schwitzen geraten sind, auch der Moderator glänzt puderlos in die Kamera. Der Kameramann empfängt während der Aufzeichnung Telefonate, und die Studiotür quietscht hemmungslos ins Geschehen.
Zwei schaurig schwitzende Schweizer
Mittendrin Trompeter Oggier Adrien und Vibrafonist Alig Dominik, die dem neugierigen Fernsehmann plausibel machen, warum man auch in der Schweiz der afrikanischen Musik zugetan ist. Die Sendung heisst Bonjour le Faso, das Studiodekor besteht aus Frischbackgipfeli, Plastikfrüchten und farbigen Tassen – und morgen dann wird Burkina Faso also von zwei schaurig schwitzenden Schweizern in den Tag geleitet.
Die eingangs erwähnte Paranoia, die in der Gruppe kursiert, rührt übrigens nicht von den etwas hartnäckigen Strassenhändlern, die sich um das Hotel der Schweizer postiert und offensichtlich bereits die Vornamen der einzelnen Musiker recherchiert haben und nun stündlich mit neuen Geschäftsideen vorsprechen.
Harassenweise importiert: Anti-Brumm
Nein, die Paranoia rührt vom Umstand her, dass Schlagzeuger Bürgin Fabian nach der ersten Nacht in Burkina Faso bereits erste Moskitoeinstiche zu beklagen hat. Gesprächsstoff Nummer eins ist nun, ob das harassenweise importierte Anti Brumm zur lebenserhaltenden und malariaabwendenden Substanz taugt oder vielleicht doch eher nicht.
Tag 2: Leichter Schwindel
Ouagadougou. Temperatur: 42 Grad. Stimmung: Hitzemüdigkeit und kreativer Taumel.
Heute steht für die Faranas ein Vorsprechen bei einem putzigen Radiosender in Ougadougou auf dem Plan. Er heisst «Pulsar» und in der Unterzeile steht der hübsche Satz: «Le petite Radio qui monte». Gespielt wird vornehmlich Jazz, gerne auch der wilderen Sorte. Es läuft alles prächtig im Interview, die Öffentlichkeitsarbeiter Oggier Adrien und Alig Dominik erklären die Faranas-Welt, es wird ein Stück von der CD gespielt, und dann kommt sie, die Frage, vor der sich alle ein bisschen gefürchtet haben, die aber sämtliche Radiomoderatoren im Frageköcher zu haben scheinen.
Es kommt nichts
Der Mann will wissen, worum es denn in diesem Liedchen, das im senegalesischen Dialekt Wolof getextet ist, bitteschön gehe. Oggier Adrien versucht Zeit zu gewinnen, räuspert sich, ja, das sei eine sehr interessante Sache, nicht ganz einfach zu erklären, es sei der Text ihres aus Senegal stammenden Sängers Mory Samb, der sei Sohn eines Griots, und, wie solle er sagen, letztlich handle es sich um die Geschichte von Hassan und Husein. Der Moderator wartet kurz, ob da noch mehr kommt – es kommt nichts – also wird erst einmal (ebenfalls ein alter Moderatorenreflex) ein Jingle eingespielt.
Später erklärt Oggier Adrien dem Chronisten, dass die Band von ihrem Sänger einst auch in Erfahrung bringen wollten, was er da genau singe. Man habe sich hingesetzt, nach drei Stunden war Mory Samb noch immer am Erzählen und Erklären. Mehr als eine blosse Geschichte, eine ganze Haltung und ein halbes Leben stecke da drin in diesem Text. Jedenfalls eindeutig zu viel fürs flüchtige Radioformat.
Anti-Brumm-Überdosis?
Heute war auch eine kleine Erfrischung einberaumt, in Form eines kurzen Betriebsausflugs zum Pool eines afrikanischen Luxus-Hotels. Bei dieser Gelegenheit stellten die Faranas-Musiker an ihren bleichen Körpern sonderbar-rötliche Hautirritationen fest. Eine Art Ausschlag, über dessen Ursache nun leidenschaftlich gerätselt wird.
Sonnenallergie, glauben die einen. Irgendwie vom Schwitzen, meinen die andern. Anzeichen einer Anti-Brumm-Überdosis denken die nächsten. Es herrscht Uneinigkeit. Man will die Sache im Auge behalten. Derweil erreichen uns Schlagzeilen aus der Schweiz über eine etwas abrupte Temparatur-Hausse auf 25 Grad, und dass nun vielen Schweizern darob just etwas schwindlig sei.
Der Gitarrist der singenden Halbgöttin
In Ougadougou ist auch ein paar Schweizern etwas hitzeschwindlig. Kommt hinzu, dass ausgerechnet heute eine kleine interkulturelle Herausforderung bevorsteht. Die Faranas sollen heute nämlich um ein Bandmitglied anwachsen. Aus Mali hat man den Gitarristen Baba Salah Cissé eingeflogen, er wird die Band an den anstehenden Konzerten begleiten. Der Mann war lange Zeit der Gitarrist von Oumou Sangaré, einer singenden afrikanischen Halbgöttin.
Der Faranas-Trompeter Oggier Adrien hatte Baba vor Jahren in Mali kennengelernt. Das Problem dieser Zusammenführung: Baba hat die CD, die man ihm von der Schweiz aus zugeschickt hat, nie erhalten, er kennt weder die Band, noch die Songs, noch weiss er genau, was diese zunächst etwas wenig zutraulichen Schweizer von ihm erwarten.
Die Übungsstätte, wo all seine Fragen geklärt werden sollen heisst «Jardin de la Musique» und liegt in Reemdoogo, nur unweit des Operndorfes, das Christoph Schlingensief errichtet hat. Der «Jardin de la Musique» ist eine Art Park mit Bühne und klimatisierten Studio- und Übungsräumen, ein Ort, wo sich neugierige Kinder nach der Schule treffen, junge und ältere Musiker ein- und ausgehen und Schulen ihren Musikunterricht absolvieren.
Baba Salah Cissé und die Faranas-Jungs fremdeln zunächst erheblich, man beäugt sich skeptisch, dann beginnen sie zu Musizieren, und nach zwei Minuten ist klar, dass da nichts mehr schiefgehen kann. Leichter Schwindel in Ouagadougou.
Tag 3: Vor dem Ernstfall
Überfahrt von Ouagadougou nach Bobo Dioulasso. Temperatur: ca. 24 Grad im Bus, 42 Grad draussen. Stimmung: abwartend.
Heute gibts den ersten musikalischen Ernstfall für die Faranas. Die Berner, die ausgezogen sind, um Afrika den helvetischen Afrobeat zu überbringen. Ein Konzert in Bobo Dioulasso, mit zirka 500’000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt Burkina Fasos. Das zurückliegende Ouagadougou ist als Stadt weitgehend unfassbar geblieben – ein Zentrum war aufs erste Hinschauen nicht zu erkennen, und ein Künstler, den man mit dem Auftrag betrauen würde, die Skyline von Ouagadougou grafisch umzusetzen, würde mittelfristig ein Leben in Malaise und Bredouille fristen.
Auf der zirka 400 Kilometer langen Überfahrt nach Bobo gibt es allerhand zu bestaunen; ein umgekippter Lastwagen, ein umgekippter Personenbus, ein nicht umgekippter, aber etwas in die Jahre gekommener Coop-Lieferwagen, und die wohl coolste Ziege Schwarzafrikas. Sie reiste auf dem Dach eines Kleinbusses und federte die Strassenunebenheiten vierbeinig-souverän aus.
Die leicht entrückte Seligkeit von Alig Dominik
Ein Passagier des Busses hat die ganze Fahrt über ein seliges Strahlen im Gesicht. Der Mann heisst Alig Dominik, bedient bei den Faranas das Vibrafon und ist gestern mal so eben seinem Abgott begegnet. Auf einmal stand er im temporär gemieteten Übungsraum der Band, begann bereits nach den ersten Takten zu Wippen und zu Strahlen und den Bernern die erhobenen Daumen entgegenzustrecken. Der Mann, der Alig Dominiks Dauerstrahlen heraufbeschworen hat, heisst Paco Séry, war einst Schlagzeuger von Nina Simone und der Taktgeber des Zawinul Syndicates. Ausserdem spiele er das Daumenpiano so dermassen schnell, dass weitherum vermutet werde, dass er vier Daumen besitze, klärt mich Alig Dominik auf. Das tut er nicht, der Chronist und Herr Alig haben es mit eigenen Augen gesehen.
Paco Séry übt im Raum nebenan für einen Auftritt am Festival Jazz à Ouaga, an dem zum Abschluss der Reise auch die Faranas spielen werden. Und seit Neuestem ist dieser Zweidäumer also ein bekennender Faranas-Anhänger. «Eine verdammt positive Energie», attestiert er den Bernern beim gemeinsamen Daumenpiano-Plausch, er wolle deren Auftritt auf keinen Fall verpassen. Seither ist Alig Dominik – auch unter normalen Umständen ein durchaus fröhliches Gemüt – von einer leicht entrückten Seligkeit illuminiert. Ansprechbar zwar, aber irgendwie anders. Nu denn.
Die Willkommensband in Bobo
Der Bus ist heil in Bobo angekommen, die Dame neben dem Saxofonisten Jan Galega Brönnimann hat wiederholt ihren Magen in eiligst herbeigeschaffte Plastiktüten entleert, Schlagzeuger Bürgin Fabian fristete ein unwirtliches Dasein unter dem Bus-Beschallungssystem, über welches eher ungünstig ausgesteuerte burkinische Telenovelas gellten. (Nur so nebenbei: Die Lieblingsthemen burkinischer Telenovelas sind untreue Frauen, schelmische Bedienstete und tyrannische Diktatoren in Tarnanzügen).
Nach der Fahrt gibts extra für die Berner ein musikalisches Empfangsständchen, ebenso zum Abendessen. Was in Europa der Willkommensapero oder der –Blumenstrauss ist, ist in Burkina Faso offenbar die Willkommensband. Mit Ruhe vor dem Konzert ist nichts. Die Faranas sind müde, die Augen klein, der Teint speckig.
Bald spielen die Weissafrikaner aus Bern ihr erstes Konzert auf dem schwarzen Kontinent. Sagen wir es so: Es wird nicht ihr bestes sein. Und sie werden daran vollkommen unschuldig sein.
Tag 4: Rasta gibt den Ton an
Bobo Dioulasso. Temperatur: 37 Grad. Stimmung: grossartig.
Gestern ist es also passiert. Das erste Afrika-Konzert der Faranas. Und das Ganze begann ganz verheissungsvoll. Der Tontechniker des Clubs – er nennt sich Rasta und er sieht auch so aus (allerdings nicht wie ein Rasta von der Sorte gemütlich-ungezwungen, sondern eher vom Schlag zaundürr und streng) – dieser Rasta also, hatte bei Ankunft der Band bereits jeden Ständer aufgestellt, und jedes Mikrofon verkabelt, und die Anlage war auch schon Gängig gemacht, ein Standard, der in der Schweiz längst nicht in jedem Club geboten wird.
Rasta war auf dem besten Weg, zum Helden des Abends zu werden, doch es sollte ein bisschen anders kommen. Ein bisschen schlechter.
Maximale Lautstärke
Der Club hiess Bois des Bènes und es war keine Spielstätte, wie wir sie hier so kennen, mit schicken geräumigen Türstehern, jungen hippen Menschen und barschem, abgestumpftem Barpersonal. Gut, das Barpersonal war in diesem speziellen Fall barsch und abgestumpft, aber ansonsten glich das Ganze eher einer hübschen Garten-Kaschemme mit eingebauter Freiluftbühne.
Dann legte Rasta los. Sein Kunstwollen bestand darin, sämtliche Instrumente in der exakt gleichen Lautstärke abzumischen, und zwar in der Maximal-Lautstärke. Seine Anlage begann bald zu übersteuern und zu krächzen; wenn der vierköpfige Bläsersatz der Faranas losschmetterte, begann das Bier aufzuschäumen und es schlotterte der Mango-Saft auf den Tischen des interessierten Publikums.
Rasta hatte zu Beginn des Konzerts jegliche Einmischung in seine Arbeit untersagt, und er hatte dies dermassen dezidiert getan, dass sich niemand vom Team getraute, sich dieser Verordnung zu widersetzen. Man weiss ja nie, in Afrika.
Nur der Saxofonist Jan Galega Brönnimann hatte den Mut aufgebracht, während des Soundchecks einzuwenden, dass der 10-Sekunden-Hall, den Rasta auf die Snare-Drum von Bürgi Fabian zu legen trachtete, vielleicht doch ein bisschen heftig sei und womöglich der Klarheit des Gesamtklangs eher abträglich sein könnte. Rasta nahm das zur Kenntnis. Seine Reaktion darauf war, dass er die Stimme des Sängers Mory Samb kurzerhand mit dem selben Halleffekt dekorierte.
Die Afro-Hardcore-Variante
Die Faranas selber präsentierten sich in prächtiger Verfassung. Der Afrobeat der Berner ist kein Abklatsch gängiger Floskeln, sie haben ihn mit traditionellen malischen Mustern angereichert, mit knackigem Funk und zünftigem Jazz-Appeal. Der malische Gastgitarrist Baba Salah Cissé hat sich ebenfalls prima in die Band eingefügt, und dermassen wohl ist ihm bereits, dass er im Bois des Bènes zu einem zirka 5-minütigen Solo ansetzte, in welchem der distinguierte Herr sich abermals auf die Knie warf, sein Spielgerät hinter dem Rücken bediente und anderweitig ausuferte.
Mit zunehmender Dauer des Konzerts gesellten sich immer mehr einheimische Trommler und Perkussionisten zu den Bernern auf die Bühne, es wurde kulturaustauscht, dass sich die burkinischen Bühnenbalken bogen. Und mittendrin, der Tonmann Rasta, dessen Mischpultkanäle allesamt im Roten flackerten und dessen Rasta-Augen zufrieden funkelten.
Faranas spielten gestern in der Afro-Hardcore-Variante, Aeberhards Andreas Bass übersteuerte ebenso wie das Vibrafon Alig Dominiks und das Bariton-Saxofon von Wyss Lisette, der einzigen Frau im Umzug. Zwischenzeitlich klang das fast ein bisschen wie eine jazzige Variante von Konono No 1, diese afrikanische Band, die deshalb hip wurde, weil sie ihre Daumenpianos mutwillig über minderwertige Verstärkeranlagen jagte und in europäischen Ohren klingt wie eine abgefahrene Bio-Elektronika-Truppe.
Die Flucht auf die Toilette
Das Publikum gibt sich trotzdem temporär tanzfreudig, am Schluss des zweieinhalbstündigen Auftritts dann aber vielleicht doch etwas erschlagen von Rastas Brachial-Afro-Klangästhetik.
Nur einer bringt es bloss auf einen zweistundenundfünfundzwanzigminütigen Auftritt an diesem Abend. Mitten in der letzten Zugabe ist Schluss für Daniel «Bean» Bohnenblust. Mitsamt Saxofon und Rucksack saust er auf einmal fluchtartig von der Bühne. In Richtung Toilette. Wir werden auch hier dranbleiben.
Tag 5: Lisette Superstar
Bobo Dioulasso. Temperatur: 39 Grad. Stimmung: Spiellaune.
Das zweite Konzert der Faranas im Land der ehrenwerten Menschen (dies die offizielle Übersetzung von Burkina Faso) findet in einem Club namens Bambou statt. Ebenfalls eine Outdoor-Anlage, ebenfalls ein lauschiges Plätzchen und ebenfalls mit einem kleinen Problemchen behaftet. Der beauftragte Techniker hat zwar ein Mischpult, Boxen und drei Kabel im Club abgestellt, doch dann ist er verschwunden und ward den ganzen Abend nicht mehr gesehen. Irgendein Notfall, wird gemunkelt.
Und nun stehen ratlose Menschen um das technische Equipment herum und versuchen – mehr gedanklich als wirklich praktisch – eine Verbindung vom Mischpult zur Tonanlage und von den Instrumenten zum Mischpult herzustellen, und irgendwann kommt man zum Schluss, dass dies mit drei Kabeln kaum zu bewerkstelligen ist. Bald erscheint ein Ersatztechniker, der aber auch gleich wieder abdreht, um fehlende Kabel und abenteuerliche Drähte herbeizuschaffen.
Die Aktion CH-Afrobeat für Afrika läuft prima an
Doch – wie immer in Afrika – gehts am Schluss dann doch irgendwie. Die Faranas spielen letztlich zwar ohne Bühnen-Boxen über einen schwächelnden Verstärker, aber sie tun es dermassen überzeugend, dass im Bambou-Club bald der Hinterste und die Letzte von ihnen hingerissen sind.
Die Aktion CH-Afrobeat für Afrika läuft prima an, die Eintritte werden einem Heim für Strassenkinder gespendet, und eine kleine, super-niedliche und grossäugige Abgesandtschaft dieser Strassenkinder darf das Vorprogramm der Berner bestreiten. Herzerweichend-allerliebst ist das.
Während des Konzerts der Faranas wird es dann zeitweise wieder ein bisschen unübersichtlich auf den Bühnenbrettern. Temporär wächst die Band etwa um fünf Personen an, mal greift ein Sänger mit einem Fela-Kuti-T-Shirt ins Geschehen ein und singt sich (gut, übrigens) die Seele aus dem Leib, mal sind es Trommler und Perkussionisten, welche die Bühne entern. Die Faranas lassen sie gewähren, sparen ihnen Platz für Soli aus und reissen das Ruder wieder an sich, wenn es sich gebietet. Baba, der Gast aus Mali, verzichtet diesmal zwar auf sein 5-Minuten-Solo mit Kniefall und Hinter-dem-Rücken-Spiel, steuert dafür ein eigenes Lied bei, das von den Faranas dankbar aufgegriffen wird.
Verwirrende Sprechchöre
Bei diesem ganzen personalaufwändigen Changieren und Kombinieren sticht indes ein Missstand ins Auge: Es fehlen die Frauen. Die einzige Dame auf der Bühne bleibt die Faranas-Baritonsaxofonistin Wyss Lisette, die bei der Vorstellung der einzelnen Musiker stets mit einem besonders herzlichen Applaus bedacht wird.
Im Bambou jedoch gehts dann sogar noch ein bisschen wilder zu und her. Kaum haben sich die Faranas von ihrem Publikum verabschiedet, setzen schon die Lisette-Sprechchöre ein. Immer lauter und einhelliger, begleitet von einem rhythmischen Klatschen. Man ist gerührt, dass das weibliche Musizieren hier in Afrika derart geschätzt wird, und so schickt man die Lisette für die erste Zugabe allein mit dem Sänger Mory Samb auf die Bühne.
Erst einige Stunden später, bei einem Bar-Gespräch mit ein paar Einheimischen, klärt sich der Irrtum auf. Man habe nicht «Lisette», skandiert, behaupten diese, sondern «Bisé», was nichts anderes als «Zugabe» bedeute. Sollen sie das nächste Mal nicht so Nuscheln, die Afrikaner. Und verdient hätte Lisette die Sprechchöre allemal. Zut alors.
Tag 6: Der Peitschenmann
Temperatur 38 Grad. Stimmung: Die Faranas haben Angst.
Gebt bloss Acht auf den Peitschenmann, riet der Mann im Hotel noch, als die Faranas ihm erzählten, dass sie die Fête des masques zu besuchen gedenken. Ein kleiner Trip ins urige Afrika sollte es werden, ein Augenschein, wie es um Tradition und Brauchtum bestellt ist, in diesem Burkina Faso. Der Peitschenmann sollte das kleinste Problem werden, soviel sei bereits vorweggenommen.
Die Fahrt ins kleine Dorf, wo die Zeremonie stattfand, war holprig, die Strassen wurden mit jedem Kilometer, den sich die Faranas dem Nest näherten, staubiger und unwegsamer. Es roch nach Abenteuer, und es sollte eins werden.
Das Dörfchen war einfach, die Hütten schlicht, und wenn man hineinspienzelte, sah man Frauen, die gemeinsam hinter diversen Kochtöpfen standen, Kinderchen spielten auf den Strassen, und auf dem Dorfplatz, in der Nähe eines Avatar-artigen Dorfbaumes fand also die grosse Zeremonie statt, das Maskenfest zum Gedenken der Ahnen und Urahnen. Und es wurde schon bald klar, dass das nicht irgendeine Touristen-Falle war, wo sich die Afrikaner das Baströckchen überstreifen, für die Urlauber lustig tanzen und singen, um sich danach wieder in T-Shirt und Jeans zu schmeissen und mit dem Motorroller davonbrausen. Nein, das hier war echt.
Die Dorf-Community hatte sich in einem grossen Kreis aufgestellt, alle hatten sich prächtig herausgeputzt, und in der Mitte des Kreises waren die Maskenmänner dabei, ihre wilden Tänze aufzuführen. Sie rotierten spektakulär durch die Luft, begleitet von Trommlern und einem Flötenmann, es staubte, die Sonne brannte und die Dorfsippe begutachtete konzentriert jede Tanzfigur und jedes Wirbeln der bunt kostümierten Gesellen.
Die Schweizer als Randerscheinung – zunächst
Dass eine Gruppe weisser Dahergelaufener diesem Ritual beiwohnt, ist offensichtlich nicht ganz üblich, demensprechend misstrauisch, aber zunächst noch freundlich, wurden die Faranas (der Bandname ist der anglo-afrikanische Ausdruck für Foreigners) beäugt, aber da die Zeremonie die volle Aufmerksamkeit forderte, war das Eintreffen der Schweizer zunächst nur eine Randerscheinung.
Dann muss es irgendwie passiert sein. Ob diese Zeremonie filmisch oder fotografisch festgehalten werden darf, darüber kursierten unter den Faranas unterschiedliche Thesen. Sie reichten von «kein Problem» bis «sehr grosses Problem», es habe drakonische Strafen zu befürchten, wer sich hier nicht an die Regeln halte. Und so entschied man sich unter den Weissafrikanern für die nicht ganz so draufgängerische Variante und beliess die Kameras schön in den Rucksäcken.
Doch so ganz alle schienen sich dann doch nicht an das Gebot zu halten. Dieser Meinung war jedenfalls ein aufgebrachter Dorfbewohner, der zwei Faranas-Schweizer bei filmischen Tätigkeiten ertappt zu haben glaubte. Und das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Obwohl die Beschuldigten versicherten, sie hätten bloss den Avatar-Baum fotografiert, war der Mann nicht mehr zu besänftigen. Er war dermassen aufgebracht, dass er dazu überging, bei anderen Dorfbewohnern gegen die weisse Minderheit Stimmung zu machen. Die Faranas warfen als Schlichtungsbeauftragten ihren Sänger, den Senegal-Schweizer Mory Samb, in die Runde, doch es half alles irgendwie nichts. Die Fronten verhärteten sich.
Irgendwann bildete sich ein Pulk ernster Mannen um die eingeschüchterten Berner Musikanten, der Gitarrist Häberlin Bernhard und Bassist Aeberhard Andreas schlugen vor, das Dorf besser sofort als zu spät zu verlassen, zumal einer dieser ernsten Männer eine Machete um seinen Hals trug.
Man entschloss sich zum Rückzug
Der einheimische Organisator des kleinen Betriebsausflugs rief den Ältestenrat herbei, die Alten reiten zu Deeskalation, gaben sich wohlwollend und zogen wieder ab. Doch der Mann – vermutlich der Beauftragte für Klatsch und Skandal des Dorfes – war noch immer nicht zu beruhigen. Er informierte immer weitere Bewohner über die vermeintlichen Fehlleistungen der Bleichgesichter. Man entschloss sich zum Rückzug, bevor auch noch der Peitschenmann von der Sache Wind bekam.
Doch weil der Guide für die Faranas noch eine urige Mittagsmahlzeit in einer Strohhütte vorgesehen hatte und es sich nicht ziemt, ein versprochenes Essen nicht einzulösen, endete die Flucht in einem engen Gelass, wo den Musikern zunächst sehr sonderbares Bier verabreicht, kurz darauf ein äusserst sonderbares, aber sehr leckeres lokales Mahl serviert wurde. Und da sassen sie nun also, die verstossenen und verängstigten Fremden, um sie herum hatten sich ein paar neugierige Schaulustige versammelt, die ihnen beim Essen ohne Essbesteck zusahen und jedes Mal entsetzt aufschrien, wenn der Linkshänder Häberlin Bernhard barhändig in den Topf griff (ein altes afrikanisches Tischgesetz besagt, dass die linke Hand nicht zur Nahrungsaufnahme, sondern zur Reinigung des Hinterteils bestimmt sei, im Esstopf also nichts zu suchen hat).
«Oh, non, les blancs»
Und dann wurde es hitzig draussen. Der Peitschenmann ging dazu über, die Dorfbevölkerung durch die Gassen zu jagen. Frauen und Kinder waren nun ebenso auf der Flucht wie Männer und Opas, es wurde geschrien und gejault, die Faranas dachten zunächst, es handle sich um einen Volksaufstand und jetzt habe endgültig das letzte Stündchen geschlagen.
Eine junge Frau, die sich mit einem beherzten Sprung in die Strohhütte im letzten Moment vor dem Peitschenmann retten konnte, rang nach der ersten Erleichterung nach Luft, dann sah sie die Faranas, schrie «oh, non, les blancs» und zog es vor, lieber draussen in die Fänge des Peitschenmannes zu geraten, als bei den weissen Ketzern und Verrätern zu bleiben.
Irgendwie haben sie es geschafft, heil da rauszukommen. Zum Schluss wurden die Faranas noch einzeln, von einem Ritual-Trommler unter die Hüpplen genommen. Seither ist wieder Ruhe eingekehrt im Camp. Auf weitere solche Kultur-Experimente wollen die Faranas jedoch künftig verzichten. Eine weise Entscheidung, findet der Chronist.
Die Faranas sind:
Rich Fonje – vocals
Mory Samb – vocals, percussion
Adrien Oggier – trumpet, percussion, kalimba
Daniel «Bean» Bohnenblust – alto sax, sopran sax, clavinet
Jan Galega Brönimann – tenor sax, sopran sax
Lisette Wyss – bariton sax
Bernhard Häberlin – guitar
Dominik Alig – vibraphon, percussion
Tonee Schiavano – e-bass
Fabian Bürgi – drums