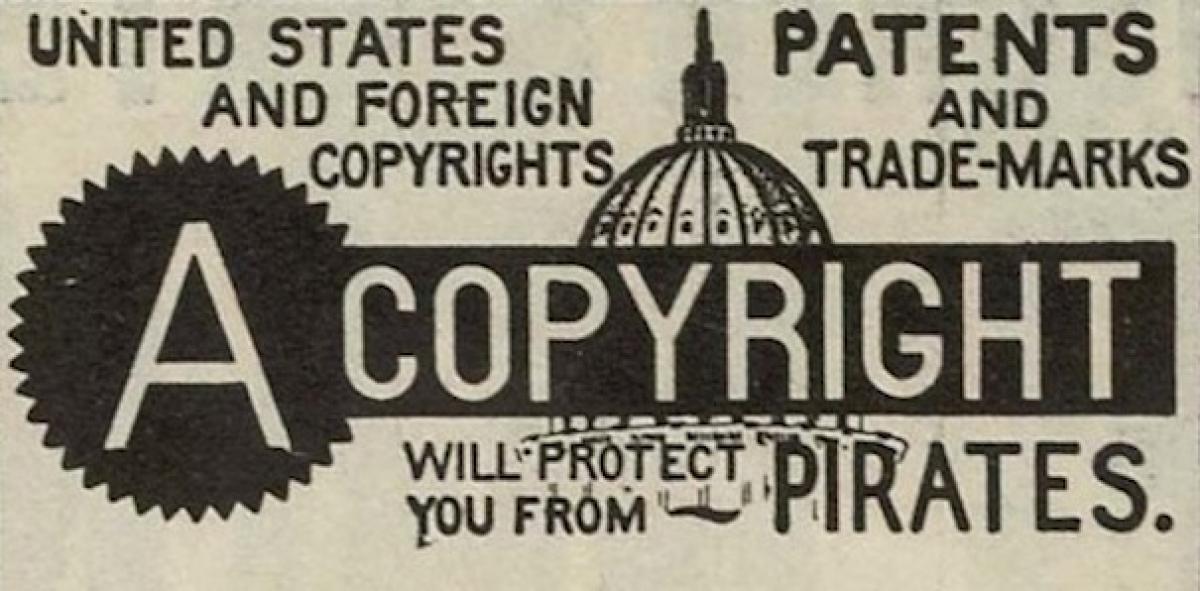
Musiker unter Anpassungsdruck
Auch Schweizer Musiker müssen sich unter dem Druck der im Internet herrschenden Gratismentalität anpassen und Eigeninitiative entwickeln. Ihre Situation unterscheidet sich in mancher Hinsicht von der ihrer ausländischen Kollegen.
Die Schweizer Pop-Musik-Szene gedeiht, als ob es die weltweite Krise des Musikbusiness nicht gäbe. Es werden mehr neue Alben veröffentlicht denn je, die stilistische Vielfalt ist gross, das Niveau steigt. Viele dieser einheimischen Musiker vermögen sich denn auch immer besser gegenüber der ausländischen Konkurrenz durchzusetzen. Jedenfalls im Inland: Es ist schon fast zur Regel geworden, dass in den Top Ten der Schweizer Hitparade drei bis fünf Alben von Schweizer Künstlern stammen.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich diese Alben auch gut verkaufen – dass diese Musiker davon leben können. Denn die Hitparade ist nur eine relative Verkaufsrangliste. Tatsächlich ist der Tonträgerumsatz auch in der Schweiz regelrecht eingebrochen. Der Gesamtumsatz des Labelverbands Ifpi Schweiz, dessen Mitglieder etwa 90 Prozent des Schweizer Marktes umsetzen, sank innerhalb von zehn Jahren von 302 Millionen Franken im Jahr 2001 um fast 60 Prozent auf 124 Millionen Franken im letzten Jahr; allein im letzten Jahr betrug der Rückgang fast 16 Prozent. Pessimistisch stimmt, dass die wachsenden digitalen Verkäufe die Verluste der physischen Tonträger nach wie vor nicht annähernd kompensieren können.
Die oft als Zukunftsmodell bezeichneten Streaming-Dienste wie Simfy oder Spotify mögen für Musikfans grossartig sein, da man sich damit sogar legal Musik gratis anhören kann, wenn man Werbung akzeptiert. Die Rechteinhaber erhalten jedoch entsprechend wenig Geld dafür. Der Musiker Reto Burrell hat errechnet, dass seine Songs 44 400-mal abgespielt werden müssen, damit er sich dafür eine Cola und ein Sandwich kaufen kann. Der Verein Musikschaffende Schweiz, dessen Präsident Burrell ist, bezeichnet diese «intransparenten» Vergütungssysteme denn auch als «Katastrophe für die Künstler».
Der Boom in der Schweizer Pop-Musik erklärt sich zu einem guten Teil damit, dass die allermeisten Künstler die Musik im Nebenerwerb betreiben, dem sie dank – im Vergleich zum Ausland – nach wie vor gut bezahlten Jobs viel Zeit widmen können. Ob dies Selbstverwirklichung oder Selbstausbeutung ist, kann dem Musikfan egal sein. Es fragt sich allerdings, ob damit der Musik nicht die existenzielle Dringlichkeit verloren geht.
Verlagerung in den Konzertmarkt
Der Musikmarkt hat sich stark von Tonträgern zu Konzerten verlagert, auch in der Schweiz. Während der Gesamtumsatz des Labelverbands Ifpi Schweiz in den letzten Jahren drastisch gesunken ist, kann der Schweizer Veranstalterverband SMPA steigende Zahlen vermelden. Seine Mitglieder, die etwa 80 Prozent des Schweizer Marktes umsetzen, vermochten den Umsatz von 173 Millionen Franken (2005) auf 281 Millionen Franken (2011) zu steigern. Der Umsatz ist mittlerweile also mehr als doppelt so hoch wie derjenige der Ifpi-Mitglieder, doch scheint nun die Marktsättigung erreicht zu sein. Umstritten bleibt die verbreitete und auch vom Schweizer Bundesrat vertretene These, wonach die Musiker die sinkenden Verkäufe von Tonträgern mit mehr Konzerten kompensieren könnten. Fachleute wie der international tätige Konzertagent und Tourneeveranstalter Berthold Seliger widersprechen: Dies gelinge nur wenigen Stars wie Madonna. Wenig bekannte Schweizer Musiker haben Mühe, Auftrittsmöglichkeiten mit rentablen Gagen zu finden.

Das hat auch mit der verschlechterten Situation vieler Musikklubs zu tun, wo solche Gruppen am ehesten auftreten können. Der Verein Petzi, der Schweizer Dachverband der nicht gewinnorientierten Musikklubs, erklärte gegenüber dem Branchenmagazin «Musikmarkt», dass in den letzten drei Jahren wohl mehr Klubs geschlossen als neue eröffnet worden seien. Gefährdet seien weiterhin viele, vor allem wegen Klagen von Anwohnern. Man wünsche sich denn auch, dass die Behörden nicht nur Subventionen sprächen, sondern Musikklubs auch proaktiv unterstützten, sprich: die Rahmenbedingungen verbesserten.
Angesichts der schwierigen Bedingungen sowohl im Tonträger- wie im Konzertmarkt haben die Tantièmen für Musiker stark an Bedeutung gewonnen. Entsprechend hat sich der Kampf ums Urheberrecht zugespitzt und tritt er nun in eine entscheidende Phase. Denn je länger die Gratismentalität des Internets geduldet wird, desto schwieriger wird eine Umkehr. Ein Blick in die Internetforen widerspiegelt das abnehmende Verständnis dafür, dass das Urheberrecht wichtig für eine florierende Kultur ist. Selbst der Bundesrat hat im letzten November in seinem «Bericht zur unerlaubten Werknutzung über das Internet» vor dieser Tendenz kapituliert. Er sah keinen Handlungsbedarf, weil das Urheberrecht «inzwischen dermassen stark als Hindernis für den Zugang zur Kultur empfunden und dessen Legitimität in einem Ausmass angezweifelt wird, dass die Piratenpartei die Befreiung der Kultur vom Urheberrecht gar als Punkt in ihr Parteiprogramm aufgenommen hat».
Inzwischen hat der Wind allerdings gedreht. Es brauchte vermutlich gerade diesen gemäss dem Musiker Christoph Trummer «geradezu beleidigenden» Bericht des Bundesrats, um die Interessengruppen des Urheberrechts zu vereinen. Zwanzig Organisationen der schweizerischen Medien- und Kulturbranche haben sich zur «Allianz gegen Internet-Piraterie» zusammengeschlossen, um für bessere Bedingungen zu kämpfen. Für den Bereich Musik entscheidend ist, dass darunter auch der Anfang 2012 gegründete Verein Musikschaffende Schweiz ist, der rund 300 Mitglieder zählt, darunter auch prominente von Bligg und DJ Bobo bis zu Yello und Züri West. Die meisten Musiker hatten sich in der Urheberrechtsdebatte bisher zurückgehalten, wohl auch aus der Angst heraus, ihre Fans zu verärgern.
Obwohl dieser Verein noch jung ist, hat er sich bereits deutlich in der Öffentlichkeit bemerkbar gemacht und ist auch im Bundeshaus vorstellig geworden. Insbesondere Präsident Reto Burrell hat offensiv die Interessen der Musiker vertreten. In den letzten Monaten haben sowohl der National- wie der Ständerat Postulate angenommen, die den Bundesrat zur Suche nach einer den Kulturschaffenden entgegenkommenden Lösung auffordern.
Modell Flat Rate
Sowohl Nationalrat Balthasar Glättli wie Ständerat Luc Recordon erwähnen in ihren Postulaten explizit Pauschalen, die bei den Internet-Benutzern erhoben würden – notabene zwangsweise. Im Zentrum steht dabei eine sogenannte Flat Rate, wie sie im Musikbereich seit einigen Jahren erörtert und etwa von Gerd Leonhard propagiert wird. Der «Medien-Futurist» hat in einem offenen Brief einen konkreten Vorschlag gemacht. Mit einer Musik-Flat-Rate von einem Franken pro Woche und Nutzer sollen das Streamen und das Downloaden von (fast) allen verfügbaren Werken legalisiert werden. Gleichzeitig könnten mit den eingenommenen Gebühren die Ansprüche aller Rechteinhaber befriedigt werden, wie er in einem Szenario vorrechnet.
So bestechend einfach der Vorschlag einer Flat Rate klingt, so findet sie bis jetzt nur wenig Unterstützung. Skeptisch bis vehement ablehnend äussern sich insbesondere Tonträgerproduzenten, Verwertungsgesellschaften und der Verein Musikschaffende Schweiz. Argumentiert wird vor allem damit, dass die Definition eines gerechten Verteilschlüssels sehr schwierig und die Pauschalbesteuerung der Konsumenten ungerecht sei, die Urheber verlören die Kontrolle über ihre Werke. Gerd Leonhard bezeichnet dies in einer Replik als «das Lamentieren der Ewiggestrigen», denn es gebe im digitalen Zeitalter «keine Lösung mehr, die perfekte Kontrolle und neue Einnahmen garantiert».

Doch auch der Bundesrat hat seine Bedenken. «Eine Entschädigung, die den Austausch nicht lizenzierter Werke im Internet abdeckt, würde auch das unerlaubte Anbieten (den Upload) mit einschliessen und damit eine sichere Heimat für illegale Plattformen wie Pirate Bay schaffen. Eine solche Lösung wäre zudem mit den bestehenden internationalen Verpflichtungen der Schweiz kaum vereinbar.» Trotzdem ist eine genauere Untersuchung mit Vorschlägen zum Thema Urheberrecht sinnvoll, wie sie Bundesrätin Sommaruga bis Ende 2013 versprochen hat. Denn bei der Entgeltung der Urheber für die Verwendung ihrer Werke in Radio und Fernsehen konnte einst auch eine einfache Lösung gefunden werden. Absehbar ist, dass der Bundesrat die im Unterschied zu vielen Nachbarländern liberale Regelung beibehalten will, wonach das Herunterladen für den Eigengebrauch legal ist. Gut vorstellbar ist, dass stärker gegen illegale Uploads vorgegangen werden soll, sprich: geltendes Recht besser durchgesetzt würde.
Eigeninitiative gefragt
Die Musiker tun gut daran, nicht politische und rechtliche Entscheidungen abzuwarten, sondern mehr Eigeninitiative zu entwickeln. Das kann mit Sponsoring sein, wie es etwa DJ Antoine praktiziert. Oder mit Crowdfunding, bei dem übers Internet Unterstützungsbeiträge für Projekte gesammelt werden. Dies wird auch in der Schweiz an Bedeutung gewinnen, zumal mit Pledgemusic seit kurzem eine auf Musik spezialisierte internationale Plattform zur Verfügung steht.
Es ist aber illusorisch zu glauben, dass Schweizer Musiker wie die amerikanische Sängerin Amanda Palmer derart eine Million Dollar auftreiben können. Die Realität für die meisten wird heissen, dass sie für kleinere, spezielle Projekte einige tausend Franken zusammenbringen. Das reicht nicht annähernd für den Aufbau einer soliden, womöglich internationalen Karriere. Die dazu nötigen Investitionen wurden lange – etwa im Fall von Gotthard – zumindest teilweise von den Plattenfirmen getätigt, denen dafür nun das Geld fehlt.
Unangemessen sind darum Vorwürfe, wenn die öffentliche Hand gezielt talentierte Künstler unterstützt. Das Musikblog 78s hatte errechnet, dass Sophie Hunger in den letzten Jahren von verschiedenen Institutionen mit insgesamt rund 250 000 Franken unterstützt wurde; diesen Frühling kamen mit dem Förderpreis des Kantons Zürich noch 40 000 Franken hinzu. Das ist viel Geld, doch ohne dieses wäre ihr neues Album vielleicht gar nie entstanden, das Ende September veröffentlicht wird.
Biography
Published on August 27, 2012
Last updated on April 30, 2024
Topics
Musicians need to pay rent and taxes. But their relationship to money is highly ambigious.
About fees, selling records, and public funding: How musicians strive for a living in the digital era.
